Eine andere Rechtswissenschaft – Die deutsche Rechtssoziologie nach 1945
Forschungsprojekt
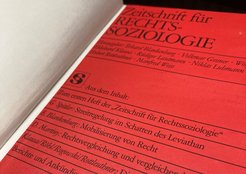
Die Wissenschaft vom Recht wird im deutschsprachigen Raum vor allem als eine normative Praxis verstanden, deren primäre Aufgabe – neben der Ausbildung des juristischen Personals – in der Produktion von praxisrelevanter Rechtsdogmatik besteht. Zugleich existiert spätestens seit der Konstituierung der Soziologie als einer ausdifferenzierten epistemischen Praxis im deutschsprachigen Raum zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine alternative Vision einer sich als „Wissenschaft“ verstehenden Beschäftigung mit dem Recht. Diese stellt die empirische Erforschung rechtlicher Phänomene in der sozialen Welt in den Vordergrund und damit Erkenntnisgegenstände, die nicht normativ gesetzt, sondern methodisch kontrolliert beobachtet werden. Das – durch die Dominanz der Rechtsdogmatik stets asymmetrische – Verhältnis dieser beiden sehr unterschiedlichen wissenschaftlichen Erkenntnisinteressen war im Laufe der Zeit sowohl von Kooperation als auch von Konkurrenz geprägt. Im deutschsprachigen Raum dominierten lange Zeit zwei Schlagworte die Diskussion. Die Verfechter einer „Rechtstatsachenforschung“ sahen ihre Aufgabe darin, sozialwissenschaftliche Erkenntnisse für eine problemadäquate Rechtsanwendung bereitzustellen. Demgegenüber wollte die „Rechtssoziologie“ das Recht als soziales Phänomen im Rahmen einer umfassenden Gesellschaftstheorie in den Blick nehmen, ohne notwendigerweise entscheidungsrelevantes Wissen zu produzieren.
Insbesondere im Gefolge der marxistisch fundierten bzw. inspirierten Gesellschaftskritik nach 1968 trat in der Bundesrepublik eine „kritische“ Rechtstheorie und Rechtssoziologie an, das Recht nicht nur anders als die Rechtsdogmatik zu beschreiben. Eine Gruppe von Juristen und Soziologen wollte das Recht auch inhaltlich und institutionell verändern, unter anderem durch Reformen der juristischen Ausbildung. Das Vorhaben scheiterte nicht nur am Widerstand der traditionellen Juristenschaft. Von dieser konfliktreichen Phase hat sich das Projekt „Rechtssoziologie“ nie mehr erholt. Die Renaissance empirischer Forschungen zum Recht in den letzten beiden Jahrzehnten erfolgte auch deshalb zum Teil unter anderem Namen („Interdisziplinäre Rechtsforschung“), unter Bezugnahme auf internationale Vorbilder („Recht und Gesellschaft“) oder unter Rückgriff auf rechtstatsächliche Erkenntnisinteressen (wie die häufig rechtsökonomisch inspirierten „Empirical Legal Studies“).
Erst seit kurzem hat eine Historisierung der Geschichte der Rechtssoziologie in Deutschland nach 1945 begonnen und erste theorie- und diskursgeschichtliche Arbeiten zur Geschichte der Rechtssoziologie liegen vor. Die Akteurs- und Institutionengeschichte der Rechtssoziologie ist bislang jedoch noch nicht monographisch aufgearbeitet worden, und es fehlen auch Arbeiten, die diese Geschichte in einen größeren wissenschaftshistorischen und -soziologischen Zusammenhang stellen und dabei auch internationale Verflechtungen in den Blick nehmen. Diese Forschungslücke wird in einem längerfristig angelegten Forschungsprojekt bearbeitet, das sich sowohl auf Archivrecherchen als auch auf Methoden der Oral History und der Digital Humanities stützt. Es baut auf den Ergebnissen und Methoden aus meinen anderen Projekten auf (Socio-legal Trajectories in Germany and the UK; Legal Theory Knowledge Graph). Das Forschungsvorhaben geht davon aus, dass die Geschichte der Rechtssoziologie in Deutschland nur in ihrer Einbettung in die Geschichte der bundesdeutschen Rechtswissenschaft verstanden werden kann. Im Zentrum steht daher das Ringen zwischen Normativität und Empirie, das sich sowohl auf theoretischer Ebene als auch in institutionellen Auseinandersetzungen manifestierte.
