Rechtskulturen des modernen Osteuropa: Traditionen und Transfers
Forschungsbericht (importiert) 2005 - Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie

Gegenüber restriktiveren Europakonzepten streng abendländisch-lateinischen Typs hat das Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte (MPIeR) seit seiner Gründung das Forschungsfeld stets unter Einschluss Osteuropas bestimmt. Schon in das vom Gründungsdirektor des Instituts, Helmut Coing, ab 1973 herausgegebene „Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte“ wurde außer Ostmittel- und Südosteuropa auch Russland aufgenommen.
An das 1992 von Dieter Simon initiierte und inzwischen abgeschlossene Projekt „Normdurchsetzung in osteuropäischen Nachkriegsgesellschaften“ schließt nun das Projekt „Rechtskulturen des modernen Osteuropa“ an, greift dabei aber weiter zurück. Ausgangspunkt ist das 19. Jahrhundert, an dessen Beginn in den verschiedenen osteuropäischen Ländern ein Modernisierungs- und Okzidentalisierungsprozess in den Rechtsordnungen einsetzte. Dieser sollte zwar später von kommunistischen Diktaturen unterbrochen werden, stellt aber doch einen notwendigen Hintergrund für das Verständnis der gegenwärtigen Integrationsbemühungen dar.
Was ist Osteuropa?
Bei allem Streit um die geographischen Grenzen Osteuropas ist die historische Eigenart Osteuropas gegenüber dem Westen darin zu sehen, dass die Gebiete östlich der Elbe und Leitha seit dem 16. Jahrhundert refeudalisiert und zur agrarischen Peripherie des westlichen Frühkapitalismus wurden. Die ausbleibende oder verzögerte Urbanisierung ging Hand in Hand mit einer deutlichen Schwäche des osteuropäischen Bürgertums. Aus diesem Grund hatte die osteuropäische Region kaum Bedarf an einer juristischen Romanisierung, wie sie im Westen des Kontinents seit dem 13. Jahrhundert stattfand. Waren es dort doch vor allem die Städte, welche neben dem Kaisertum und der Kirche die Rezeption des römischen Rechts vorantrieben.
Die rechtshistorische Eigenart Osteuropas beruht also zunächst einmal auf der fehlenden Rezeption des römischen Rechts. Diese rein negativ definierte Einheit osteuropäischer Rechtsgeschichte schließt eine – folgenreiche – Binnendifferenzierung Osteuropas in zwei Zonen nicht aus, nämlich in die byzantinisch und in die lateinisch geprägten Rechtskulturen.
Auswahl der Länder
Für die Projektarbeit wurden deshalb sowohl Länder mit byzantinisch-orthodoxer Rechtskultur als auch solche mit okzidental-lateinischer Rechtskultur ausgewählt. Ferner fanden Länder Berücksichtigung, die den Rechtstransfer durch Gesetzgebung vollzogen, und Länder, die den Transfer allein durch die Übernahme westlicher Rechtsdogmatik und Rechtslehren bewirkten. Diese Auswahl erlaubt, das Gewicht der rechtshistorisch-kulturellen Vergangenheit (einschließlich religiöser Voraussetzungen) in einem juristischen Transferprozess einzuschätzen und darüber hinaus zu beobachten, ob Gesetzgebung im Vergleich zu „sanften“ Übernahmen durch Wissenschaft Transferprozesse beschleunigt oder blockiert.
In Arbeit sind nach den genannten Kriterien Russland (mit Baltikum), Polen, Ungarn, Kroatien, Böhmen, Slowakei und Rumänien. Rechtstransferprozesse sind zum Beispiel vergleichend zu beobachten zwischen zwei Ländern, die beide den Transfer westlicher Rechtsmodelle rein rechtsdogmatisch-justiziell vollzogen, wobei aber das eine Land, Russland, byzantinisch-orthodox geprägt ist, während das andere, Ungarn, deutlich in okzidentaler Tradition steht. Zu vergleichen sind ebenso zwei Länder, die beide den Transfer durch Gesetzgebung, nämlich den Code civil, vornahmen, wobei aber das eine Land, Rumänien, einen byzantinisch-orthodoxen Hintergrund hat, während das andere, Polen, okzidental-lateinisch geprägt ist.
Rechtstransfer
Grundlage des Modernisierungprozesses war eine – teils freiwillige, teils oktroyierte – Übernahme westlicher Kodifikationen und Rechtslehren in den osteuropäischen Ländern. Erste Explorationen der historischen Rezeptionsvorgänge fanden unter Teilnahme zahlreicher Wissenschaftler aus Osteuropa bei zwei Tagungen in den Jahren 2002 und 2003 statt. Es wurde vereinbart, den Begriff „Rezeption“ durch „Transfer“ zu ersetzen. „Rezeption“ suggeriert, dass ein „Nehmerland“ ein fremdes Recht tel quel übernehmen könne und dieses „transplantierte“ Recht in neuer Umgebung im Wesentlichen identisch bleibe. Die in Osteuropa zu beobachtenden Prozesse der Übernahme westlicher Rechte offenbaren hingegen schnell, dass der Vorgang wesentlich komplexer ist. Die fremden Rechte trafen auf traditionelle Rechtsordnungen, welche in höchst unterschiedlicher Weise auf diesen Aufprall reagierten. Eher als von „Rezeption“ ist daher von „Irritation“ bestehender Rechtssysteme zu sprechen. Im Anschluss an interdisziplinäre Transferforschungen hat das Projekt daher sein theoretisches Fundament in einem Modell operativ geschlossener und kognitiv offener, damit auch störempfindlicher Systeme gefunden.
Zu fragen ist dann, welche Institutionen und Operationen an dem Transferprozess – sei es diesen fördernd und beschleunigend, sei es ihn unterlaufend und hemmend – maßgeblich beteiligt waren. Von besonderer Bedeutung dürften sein: das Wissenschaftssystem (Rechtswissenschaft), das Erziehungssystem (Juristenausbildung) und schließlich das Zentrum des Rechtssystems (Rechtsprechung).
Rechtswissenschaft und Juristenausbildung
Die modernen westlichen Gesetzbücher und Verfassungen trafen in Osteuropa auf unvorbereiteten Boden. Der Schock des schnellen Transfers wurde von der osteuropäischen Rechtswissenschaft verarbeitet und abgefedert. In jenen Ländern Osteuropas, in denen der kodifikatorische und konstitutionalistische Transfer gescheitert war, war es allein die Rechtswissenschaft, die Transferprozesse in Gang zu setzen – oder auch zu blockieren – vermochte.
Die Schlüsselrolle der Rechtswissenschaft in den Prozessen des Rechtstransfers legt die Bedeutung der entsprechenden Schulung des Juristenstandes nahe. In diesem Bereich wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts überall in Osteuropa die zunächst sehr schmale Bildungselite, die an westlichen Universitäten studiert hatte, durch einen modernen, mitunter sogar in Überzahl vorhandenen Rechtsstab heimischer Herkunft ersetzt.
Die Arbeiten an den Formen und am Wandel der osteuropäischen Rechtswissenschaft und der Juristenausbildung seit dem frühen 19. Jahrhundert sind weit fortgeschritten. Erste Ergebnisse zeigen, vorbehaltlich aller Unterschiede im Detail, dass beide Faktoren für Erfolg oder Misserfolg von Rechtstransfers eine entscheidende Rolle spielen. Deutlich wurde, dass ein Transfer durch Wissenschaft im Vergleich zum Transfer durch Gesetzgebung mehr Zeit beansprucht, aber nachhaltiger sein kann. Wo sich die Wissenschaft – und in ihrem Gefolge regelmäßig die Juristenausbildung – einem Transfer widersetzte, geriet dieser regelmäßig ins Stocken. Die eigentliche Probe für diese ersten Thesen steht aber noch aus.
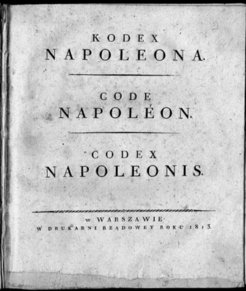
Schwerpunkt Rechtsprechung
Denn inwieweit das lokale Recht durch den Federstrich des westlich inspirierten Gesetzgebers oder durch die Bemühungen der Rechtswissenschaft verdrängt wurde oder sich diesem widersetzte, lässt sich nur durch eine gründliche Analyse der Rechtsprechung in den ausgewählten Ländern nachprüfen. Die Forschungsstrategie für diese aufwändige Analyse ist inzwischen entwickelt worden.
Insbesondere in Bezug auf die Länder des legislativen Transfers lässt eine Aufarbeitung der Rechtsprechung während der ersten Dekaden nach dem Transfer westlicher Gesetzestexte Aufschluss über dessen Erfolg, aber auch über eventuelle Nebenwirkungen und die Beharrungskraft traditioneller juristischer Kommunikationen erwarten.
Gegenwärtig werden im Rahmen des Projekts zehn Unterprojekte gefördert, die Probeanalysen an einzelnen zeitlichen und sachlichen Abschnitten der Rechtsprechung vornehmen. Darunter sind zum Beispiel: „Modernisierung des Grundeigentums in Estland bis zum Ersten Weltkrieg“, „Richterliche Rechtspraxis in Ungarn von 1840 bis 1944“ und „Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts in polnischen Gebieten“.
Netzwerk
Die mehrjährige intensive Zusammenarbeit des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte mit osteuropäischen Wissenschaftlern hat gezeigt, dass ohne kooperationsbereite Institutionen und Personen „vor Ort“ ein Projekt wie das vorgestellte keine Chancen auf Realisierung hat. Ein Scientific Board, dem west- und osteuropäische Experten angehören, unterstützt das inzwischen aufgebaute Netzwerk. Um die Zusammenarbeit auch in Zukunft zu sichern, hat das Institut mit freundlicher Unterstützung der Gemeinnützigen Hertie Stiftung zudem ein Osteuropa-Seminar mit dem Titel „Grundlagen des Rechts“ ins Leben gerufen. An ihm nahmen im Herbst 2005 sechzehn junge Rechtswissenschaftler des osteuropäischen Raums teil. Die fast vierzehntägige, sehr erfolgreiche Zusammenarbeit im Seminar verspricht eine Erweiterung des bestehenden Netzwerks durch herausragende Nachwuchswissenschaftler.

